Inklusion und Exklusion 1939 bis 1945
Die nächste Phase, die eine drastische Intensivierung der Exklusionspolitik einläutete, stand ab 1939 an – eine Erkenntnis, die zugleich auch nochmal den analytischen Wert eines auf kriegsgesellschaftliche Dynamiken fokussierten Ansatzes deutlich macht. Denn ab jenem Jahr wurden die Juden im Reich als nationalsozialistischer Perspektive als veritable Bedrohung – im Sinne eines „inneren Feindes“ – wahrgenommen, und dies vor dem Hintergrund des Legende des „Dolchstoßes“ von 1918, welche sich (u. a.) in den Köpfen der NS-Führung festgesetzt hatte (vgl. Kruse 2015: 241): Aus deren Sicht „drohen die Juden erneut die deutsche Kampfkraft zu unterminieren“ (Kruse 2015: 241). Nachdem zunächst vor diesem Hintergrund der Judenstern zur Kennzeichnung eingeführt wird, verstärkt sich der Druck auf Hitler, die Juden in Gebiete außerhalb des Reiches zu deportieren – zahlreiche Pläne diesbezüglich, die als Zielorte mal Lublin in Polen, mal die Sowjetunion bzw. Sibirien und mal Madagaskar vorsahen, scheiterten jedoch immer wieder an den militärischen Gegebenheiten und Entwicklungen des Krieges (vgl. ebd.: 241f.). Die Folge ist schließlich die „Endlösung“ – die äußerste Form der Exklusion, die überhaupt möglich ist: „So mündet die geplante Deportation einer ethnischen Minorität, die eine für die Zeit der Weltkriege übliche Praxis gewesen wäre, in den Genozid am europäischen Judentum, dem sechs Millionen Menschen zum Opfer fallen“ (ebd.: 242). Gleichwohl ließe sich der Genozid an den europäischen Juden, so Kruse, nicht auf eine kriegsbedingte Strukturlogik zurückführen, da ein solcher Massenmord an Menschen, die ansonsten als Arbeitskräfte hätten eingesetzt werden können, auch aus kriegsgesellschaftlicher Logik heraus unzweckmäßig gewesen sei (vgl. ebd.: 242). Allerdings wirkte auch hier das Trauma von 1918 weiter: „Aus Sicht der nationalsozialistischen Führung war der Entschluss zum Judenmord bei aller affektiven Aufgeladenheit eine letztendlich rationale Entscheidung. Die Gefahr der Juden als ‚Zersetzer‘ der Heimatfront wurde als größer eingeschätzt als ihr ökonomischer Nutzen als Zwangsarbeiter“ (ebd.: 243).
Kruses Differenzierung zwischen kriegsbedingten, immer auch auf kriegswirtschaftliche Erfordernisse ausgerichteten Strukturlogiken einerseits und den Auswirkungen politischer Ideologien andererseits, welche u. a. durch politisch-historische Traumata und deren Folgen begründet sind, ist für uns an dieser Stelle nochmal eine außerordentlich wichtige Erkenntnis, die es festzuhalten gilt. So birgt sie immerhin auch die Folgerung in sich, dass eine kriegsbedingte Strukturlogik nicht zwingend identisch sein muss mit den Operationen, die im Falle eines sozialen Systems aus der Freund-Feind-Unterscheidung heraus folgen. Während erstere in diesem konkreten historischen Fall somit wohl eher zur Verwendung der exkludierten Gruppen in Form von Zwangsarbeit geführt hätte, führte letztere in diesem Falle zum Genozid. Dies zeigt zugleich auch auf, dass eine rein auf kriegsgesellschaftliche Dynamiken abstellende soziologische Perspektive allein nicht ausreicht, um derlei gesellschaftsstrukturelle Entwicklungen und deren Folgen – bis hin zu einem Genozid – vollumfänglich zu erfassen. Trotz jüngerer politikwissenschaftlicher Forschungen über sogenannte „neue Kriege“ und des besonderen Phänomens des „Bürgerkrieges“ ist der Kriegsbegriff doch – zumal mit Blick auf das 20. Jahrhundert – immer primär an „konventionelle“ internationale Auseinandersetzungen zwischen Nationalstaaten bzw. Reichen und Imperien geknüpft, an „außenpolitische“ Vorgänge, in deren Kontext ethnisch und / oder religiös und / oder politisch begründete Exklusionen „im Inland“, erst recht aber Genozide, zunächst einmal eher außergewöhnliche Erscheinungen darstellen. Es wäre – wie die oben beschriebene Erkenntnis aufzeigt – irreführend, es hier makrosoziologisch bei der These der Kriegsgesellschaft zu belassen, welche, auch in diesem, hier dargestellten Fallbeispiel, zwar unzweifelhaft vorliegt – sogar als „extreme Variante kriegsbedingter Vergesellschaftung“ (ebd.: 243; Hervorhebungen entfernt), allerdings erst ab Kriegsbeginn (vgl. ebd.: 245) –, die aber nur eine (wenn auch gewichtige) Facette der politischen Freund-Feind-Leitdifferenz darstellt, die genauso nach innen wirkte und dabei so wirkmächtig war, dass sie sogar konventionelle, klassisch kriegsgesellschaftliche Strukturlogiken außer Kraft setzen konnte. Es bedarf daher, vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis, immer auch des soziologischen Blickes auf die Folgen einer (in diesem Fall politisierenden) funktionalen Entdifferenzierung und der durch diese systemübergreifend wirkenden Leitunterscheidung.
Auf der Inklusion der einen und der Exklusion der anderen wurde die dadurch scharf abgegrenzte „Volksgemeinschaft“ als nationalsozialistisches Gesellschaftsmodell begründet – die Zielvorstellung eines durch die Freund-Feind-Logik politisierten Gesellschaftssystems. Insbesondere das Vorhandensein eines (gezielt politisch konstruierten) Feindes erlaubte dabei auch die Herausbildung von Gemeinschaftlichkeit über den – sozialpsychologisch wirkungsvollen – Aspekt der „Gefahrengemeinschaft“: Eine Gruppe, die sich gemeinsam von etwas bedroht sind, erhöht die Integrationskraft nach innen. Nach Fraenkel ist es dabei unmaßgeblich, ob der postulierte Feind tatsächlich existiert oder lediglich durch umfassende politische Propaganda konstruiert und inszeniert wird (vgl. Fraenkel 1984: 231): „Maßgeblich ist allein, ob der Feind-Komplex ausreichend lebendig erhalten wird, um den Gedanken an die Errichtung einer an rationalen Wertvorstellungen ausgerichteten Gesellschaftsordnung gar nicht aufkommen zu lassen“ (Fraenkel 1984: 231). Die Bezugnahme auf „Rationalität“ als Grundlage einer Gesellschaftsordnung muss dabei im Sinne der Weber-Typologie verstanden werden, die auf rationale Herrschaftslegitimation abstellt, welche die Grundlage bildet für den modernen liberal-parlamentarischen Staat. Der Antisemitismus der Nationalsozialisten war somit für Fraenkel niemals nur ein affektiv gegebenes, weltanschaulich vorhandenes Element der NS-Ideologie, sondern immer auch ein Instrument zur Ausdifferenzierung der Volksgemeinschaft und zur Einschränkung der Freiheit bzw. zum Erhalt und Ausbau der politischen Macht: „Die Bedrohung durch die rassische Gefahr, die die Juden der nationalsozialistischen Theorie zufolge darstellen, soll integrierend wirken“ (ebd.: 232).
Wie viel „Gemeinschaft“ steckte soziologisch betrachtet in jener Gesellschaft? Die von Ferdinand Tönnies (1926) vorgenommene Unterscheidung von „Gesellschaft“ und „Gemeinschaft“ gehört zu den Klassikern der deutschen Soziologie. Obwohl sich der in diesem Rahmen entstandene Gesellschaftsbegriff mehr als grundlegend von jenem der soziologischen Systemtheorie nach Luhmann unterscheidet, welchen auch wir hier verwenden, so bietet die Unterscheidung nach Tönnies, nach der die Gesellschaft eine Art Abgrenzungsbegriff zur Gemeinschaft ist, doch einige interessante Implikationen, die es wert sind, auch beim Blick auf gesellschaftliche Entdifferenzierung im Nationalsozialismus näher beleuchtet zu werden.
Die Gemeinschaft gilt demnach als ein „älterer Modus kollektiver Existenz“ (Zapfel / Promberger 2011: 7), welcher sich etwa in traditionellen Großfamilien, Dorfgemeinschaften und religiösen Gemeinden manifestierte, sich durch traditions- und affektbasierte Lebensverhältnisse, eine hohe Interaktionsdichte, emotionale Nähe, Gefühlstiefe und gegenseitige Hilfsbereitschaft und persönliche Beziehungen auszeichnete und in der sich die Individualität dem Kollektiv unterzuordnen hat (vgl. Zapfel / Promberger 2011: 7). Die Gesellschaft ist nach Tönnies demgegenüber ein modernes soziales Phänomen und ein Produkt von Industrialisierung und der daraus resultierenden verstärkten Interdependenz einer immer größeren Anzahl von Menschen miteinander. Da diese jedoch aufgrund ihrer deutlich höheren Anzahl zumeist in einem anonymen Verhältnis zueinander stehen – also nicht zwingend miteinander interagiert wird – hat das Kollektivbewusstsein in der Gesellschaft stark an Bedeutung eingebüßt: Stattdessen müssen nun Symbole wie Flaggen, Hymnen und Währungen dem Einzelnen das Gefühl sozialer Zugehörigkeit vermitteln (vgl. ebd.: 10). Gesellschaft wird in diesem Sinne also noch als Nationalgesellschaft und somit mit dem Politischen verquickt verstanden: „Fiktive Gemeinschaftskonstrukte (…) – teils ideologisch überhöht wie Volks- und Schicksalsgemeinschaft – wurden im politischen Diskurs eingeführt, um auf Gesellschaftsebene eine Vertrautheit der Menschen miteinander zu suggerieren“ (ebd.: 10).
Nun ist dies zwar ein grundlegend anderer Zugang zum Begriff der Gesellschaft als der einer „Gesamtheit aller Kommunikationen“, aber gerade in der Abgrenzung zur Gemeinschaft wird eine ähnliche Vorstellung von gesellschaftlicher Evolution deutlich: Wo Luhmann den Übergang von segmentär und stratifiziert differenzierten hin zur funktional differenzierten Gesellschaft ausmacht, da sieht Tönnies (1926) den Übergang von der Gemeinschaft zur Gesellschaft. Stärker auf Interaktion basierende „Segmente“ und Gemeinschaften in der Ständegesellschaft werden durch von der Interaktionsebene klar zu unterscheidende gesellschaftliche Funktionssysteme ersetzt, die – parallel auch zu modernen Prozessen wie der Urbanisierung – soziales Zusammenleben „anonymisieren“. Ein wesentlicher Vorgang, der diese Anonymisierung bzw. Loslösung von Interaktion als leitendem Kommunikationsmodus begleitet (oder gar vorantreibt?) ist der der funktionalen Ausdifferenzierung. Indem diese auf die Weltgesellschaft hinarbeitet, indem sie Kommunikation vom regionalen Rahmen löst, indem sie Kommunikation, mit Carl Schmitt (2015: 81) gesprochen, entpolitisiert, treibt er das voran, was Tönnies unter Gesellschaft versteht.
Das oben bereits angedeutete, „ideologisch überhöhte, fiktive Gemeinschaftskonstrukt“ der Volksgemeinschaft ist eines der tragenden Konzepte des Nationalsozialismus gewesen. Es spricht jedoch vieles dafür, dass es hier um mehr ging als um einen Versuch, im politischen Diskurs zwischenmenschliche Vertrautheit zu suggerieren. Der Begriff der „Volksgemeinschaft“ war mehr als bloß propagandistische Rhetorik seitens des Regimes – er war die intendierte Konsequenz dessen, was mit einer Re-Politisierung der Gesellschaft in jenem Sinne, in dem etwa Schmitt (2015) sie beabsichtigt hatte, und damit mit einer umfassenden gesellschaftlichen Entdifferenzierung, eintreten sollte. Das, was nach Schmitt das Politische ausmacht, nämlich die Unterscheidung von Freund und Feind, schuf, sicherte und bewahrte nach dieser Auslegung die Volksgemeinschaft, indem es sie von „feindlichen“ Elementen abgrenzte und politische Institutionen installierte, die dieses weiterhin umsetzen und gewährleisten sollten. Die „totalitäre“, vom politischen System ausgehende Entdifferenzierung sollte eben diese umfassende (Re-)Politisierung der Gesellschaft und damit ihre Transformation hin zu einer „Volksgemeinschaft“ einleiten, so dass „im Dritten Reich ‚das Politische‘ nicht einen abgegrenzten Sektor der Staatstätigkeit darstellt, sondern zum mindesten potentiell das gesamte öffentliche und private Leben umfaßt“ (Fraenkel 1984: 98).
Dabei ging es um weit mehr als nur „Suggestion“: Die Rückkehr zum Kollektiv, welches über dem Individuum steht, war ja nicht bloße Rhetorik, sondern politisches Programm („Du bist nichts, dein Volk ist alles!“). Das, was nach Tönnies also die „Gemeinschaft“ ausmacht und was hier aus ersichtlichen Gründen schwer erreicht werden konnte, nämlich eine hohe Interaktionsdichte als „Bindungsmittel“, sollte kompensiert werden nicht nur durch die oben genannte, politisch übliche Symbolik, sondern durch andere, eher „reichsweit“ zu verwirklichende Gemeinschaftselemente wie eben jene traditions- und affektbasierten Lebensverhältnisse, der besagte Kollektivismus oder politisch organisierte gegenseitige Hilfsbereitschaft innerhalb der Volksgemeinschaft (das sozialistische Element des Dritten Reiches), etwa in Form des „Winterhilfswerks“ und zahlreicher anderer Einrichtungen. Der größte und wichtigste Integrator war aber eben der politische Funktionscode: Die soziale Konstruktion eines gemeinsamen Feindes schafft untereinander Integration und füllt dadurch jene Lücke, die sich durch den Mangel an Nähe durch Interaktion auftut. Die Volksgemeinschaft kann also in diesem Sinne durchaus als eine neuartige, politisch organisierte Form von Gemeinschaft im Sinne Tönnies‘ gesehen werden, die sich zwar teils durch einen anderen Charakter als die klassische (und schlicht kleinere) Gemeinschaft auszeichnet, die aber eben weit mehr ist als nur suggestive Rhetorik, und die auf eine umfassende Transformation dessen hinzielt, was in diesem Sinne die Gesellschaft darstellt.
Aus dieser Diagnose lässt sich ableiten, was Entdifferenzierung im Sinne einer Politisierung der Gesellschaft eben auch zu sein scheint: Eine Reaktion auf die gesellschaftliche Evolution nicht nur hin zur funktionalen Differenzierung, sondern auch zu dem, was Tönnies unter „Gesellschaft“ versteht. Beides erhöhte die Komplexität und die Kontingenz der Gesellschaft, was zu einer „Modernisierungskrise“ führte. Die Schritte hin zu einer politischen Neucodierung im Sinne der Unterscheidung von Freund und Feind, zur daraus generierten Inklusion all jener, die unter die Positivseite des Codes fielen, zur massiven und letztlich totalen Exklusion all jener, die man der Negativseite zurechnete, und damit letztendlich zur politisch determinierten Ausdifferenzierung einer nationalsozialistisch geformten Volksgemeinschaft stehen damit in einem jeweils unmittelbaren sozialstrukturellen Zusammenhang zueinander. Die Vorstellung von der deutschen Volksgemeinschaft war, letzten Endes, die Gesellschaftstheorie des Nationalsozialismus. Im Rahmen NS-rechtstheoretischer Semantik wurde das Primat des Politischen so etwa auch als „Primat des Volkes“ gedeutet (vgl. Dräger 1935).
Wir haben diesen Exkurs an dieser Stelle eingeschoben, um damit deutlich zu machen, dass die nationalsozialistische Vorstellung der Volksgemeinschaft nicht nur ein abstraktes oder oberflächliches, politrhetorisches Schlagwort darstellte, sondern ein politisches Konzept, ein politisches Programm, dessen Umsetzung, wie Kruse gezeigt hat (s. o.), mittels der aus der Freund-Feind-Unterscheidung folgenden, aktiven Inklusions- und Exklusionspolitik klar erkennbar angestrengt wurde. In diesen Zusammenhang lässt sich sodann auch die (mindestens versuchte) funktionale Entdifferenzierung zwischen Politik und Recht bzw. auch jene zwischen dem politischen System und anderen Funktionssystemen neben dem Recht einordnen: Die Politisierung der Gesellschaft unter der Maßgabe des politischen Codes, die „feindliche(n) Übernahme(n)“, um Schimanks (2006) Terminologie zu verwenden, hatte(n) aus Sicht der Nationalsozialisten den Sinn der gesellschaftsstrukturellen Transformation hin zur Volksgemeinschaft, zur Verwirklichung der nationalsozialistischen Gesellschaftstheorie. Gesellschaftsweite Inklusion der „Volksgenossen“ bzw. gesellschaftsweite Exklusion aller, die man nicht dazuzählte, war eben nur durch umfassende gesellschaftliche Kontrolle durch das dementsprechend gepolte politische System zu verwirklichen – nicht aber unter der Bedingung weiterhin bestehender Autonomie der übrigen gesellschaftlichen Teilsysteme: „Wird die Volksgemeinschaft zum Fetisch erhoben, so folgt daraus (…) die Negierung des Rechts als Eigenwert, die Absage an jegliche rationale naturrechtliche Normen und die Identifizierung von Recht und Zweckmäßigkeit“ (Fraenkel 1984: 233; Hervorhebungen F. S.).
Fraenkel beschreibt damit, in seinen Worten, nichts anderes als den politisch determinierten Autonomieverlust des Rechtssystems. Für die NS-Rechtstheorie formulierte Heinz Hildebrandt diese Politisierung des Rechts durch die Ideologie der Volksgemeinschaft wie folgt: „Endzweck allen Rechts ist im nationalsozialistischen Staat die Sicherung und Förderung der deutschen Blutsgemeinschaft“ (Hildebrandt 1935: 56). Das Recht sollte fortan unter dem Primat der politischen Freund-Feind-Unterscheidung funktionieren. Die für den Autonomieverlust des Rechts ursächliche funktionale Entdifferenzierung als Teil der NS-Programmatik bildet dabei das maßgebliche Herrschaftsinstrument: „Gäbe es keine Volksgemeinschaft, könnte man Gemeinschaften, die sich auf religiöse, soziale oder politische Werte gründen, nicht unterdrücken“ (Fraenkel 1984: 233). Im Zweifel müsste ein Feind erfunden werden, wenn es keinen realen mehr gäbe, um den Mythos vom Dauernotstand (bzw.: den Ausnahmezustand) aufrecht zu erhalten – und damit die Volksgemeinschaft (vgl. Fraenkel 1984: 233).
Literatur
Dräger, Werner (1935). Primat des Volkes. Ein Beitrag zur Grundfrage einer völkischen Staatslehre. Neue Deutsche Forschungen, Bd. 34. Berlin: Junker und Dünnhaupt.
Fraenkel, Ernst (1984). Der Doppelstaat. Recht und Justiz im „Dritten Reich“. Frankfurt a. M.: Fischer.
Hildebrandt, Heinz (1935). Rechtsfindung im neuen deutschen Staate. Ein Beitrag zur Rezeption und den Rechtsquellen, zur Auslegung und Ergänzung des Gesetzes. Schriften der Akademie für Deutsches Recht. Berlin / Leipzig: Walter de Gruyter.
Kruse, Volker (2015). Kriegsgesellschaftliche Moderne. Zur strukturbildenden Dynamik großer Kriege. München / Konstanz: UVK.
Schimank, Uwe (2006). „Feindliche Übernahmen“: Typen intersystemischer Autonomiebedrohungen in der modernen Gesellschaft. In: Ders., Teilsystemische Autonomie und politische Gesellschaftssteuerung: Beiträge zur akteurszentrierten Differenzierungstheorie 2. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 71-83.
Schmitt, Carl (2015). Der Begriff des Politischen. Text von 1932 (9., korrigierte Aufl.). Berlin: Duncker & Humblot.
Tönnies, Ferdinand (1926). Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie (7. Aufl.). Berlin: Curtius.
Kruses Differenzierung zwischen kriegsbedingten, immer auch auf kriegswirtschaftliche Erfordernisse ausgerichteten Strukturlogiken einerseits und den Auswirkungen politischer Ideologien andererseits, welche u. a. durch politisch-historische Traumata und deren Folgen begründet sind, ist für uns an dieser Stelle nochmal eine außerordentlich wichtige Erkenntnis, die es festzuhalten gilt. So birgt sie immerhin auch die Folgerung in sich, dass eine kriegsbedingte Strukturlogik nicht zwingend identisch sein muss mit den Operationen, die im Falle eines sozialen Systems aus der Freund-Feind-Unterscheidung heraus folgen. Während erstere in diesem konkreten historischen Fall somit wohl eher zur Verwendung der exkludierten Gruppen in Form von Zwangsarbeit geführt hätte, führte letztere in diesem Falle zum Genozid. Dies zeigt zugleich auch auf, dass eine rein auf kriegsgesellschaftliche Dynamiken abstellende soziologische Perspektive allein nicht ausreicht, um derlei gesellschaftsstrukturelle Entwicklungen und deren Folgen – bis hin zu einem Genozid – vollumfänglich zu erfassen. Trotz jüngerer politikwissenschaftlicher Forschungen über sogenannte „neue Kriege“ und des besonderen Phänomens des „Bürgerkrieges“ ist der Kriegsbegriff doch – zumal mit Blick auf das 20. Jahrhundert – immer primär an „konventionelle“ internationale Auseinandersetzungen zwischen Nationalstaaten bzw. Reichen und Imperien geknüpft, an „außenpolitische“ Vorgänge, in deren Kontext ethnisch und / oder religiös und / oder politisch begründete Exklusionen „im Inland“, erst recht aber Genozide, zunächst einmal eher außergewöhnliche Erscheinungen darstellen. Es wäre – wie die oben beschriebene Erkenntnis aufzeigt – irreführend, es hier makrosoziologisch bei der These der Kriegsgesellschaft zu belassen, welche, auch in diesem, hier dargestellten Fallbeispiel, zwar unzweifelhaft vorliegt – sogar als „extreme Variante kriegsbedingter Vergesellschaftung“ (ebd.: 243; Hervorhebungen entfernt), allerdings erst ab Kriegsbeginn (vgl. ebd.: 245) –, die aber nur eine (wenn auch gewichtige) Facette der politischen Freund-Feind-Leitdifferenz darstellt, die genauso nach innen wirkte und dabei so wirkmächtig war, dass sie sogar konventionelle, klassisch kriegsgesellschaftliche Strukturlogiken außer Kraft setzen konnte. Es bedarf daher, vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis, immer auch des soziologischen Blickes auf die Folgen einer (in diesem Fall politisierenden) funktionalen Entdifferenzierung und der durch diese systemübergreifend wirkenden Leitunterscheidung.
Auf der Inklusion der einen und der Exklusion der anderen wurde die dadurch scharf abgegrenzte „Volksgemeinschaft“ als nationalsozialistisches Gesellschaftsmodell begründet – die Zielvorstellung eines durch die Freund-Feind-Logik politisierten Gesellschaftssystems. Insbesondere das Vorhandensein eines (gezielt politisch konstruierten) Feindes erlaubte dabei auch die Herausbildung von Gemeinschaftlichkeit über den – sozialpsychologisch wirkungsvollen – Aspekt der „Gefahrengemeinschaft“: Eine Gruppe, die sich gemeinsam von etwas bedroht sind, erhöht die Integrationskraft nach innen. Nach Fraenkel ist es dabei unmaßgeblich, ob der postulierte Feind tatsächlich existiert oder lediglich durch umfassende politische Propaganda konstruiert und inszeniert wird (vgl. Fraenkel 1984: 231): „Maßgeblich ist allein, ob der Feind-Komplex ausreichend lebendig erhalten wird, um den Gedanken an die Errichtung einer an rationalen Wertvorstellungen ausgerichteten Gesellschaftsordnung gar nicht aufkommen zu lassen“ (Fraenkel 1984: 231). Die Bezugnahme auf „Rationalität“ als Grundlage einer Gesellschaftsordnung muss dabei im Sinne der Weber-Typologie verstanden werden, die auf rationale Herrschaftslegitimation abstellt, welche die Grundlage bildet für den modernen liberal-parlamentarischen Staat. Der Antisemitismus der Nationalsozialisten war somit für Fraenkel niemals nur ein affektiv gegebenes, weltanschaulich vorhandenes Element der NS-Ideologie, sondern immer auch ein Instrument zur Ausdifferenzierung der Volksgemeinschaft und zur Einschränkung der Freiheit bzw. zum Erhalt und Ausbau der politischen Macht: „Die Bedrohung durch die rassische Gefahr, die die Juden der nationalsozialistischen Theorie zufolge darstellen, soll integrierend wirken“ (ebd.: 232).
Wie viel „Gemeinschaft“ steckte soziologisch betrachtet in jener Gesellschaft? Die von Ferdinand Tönnies (1926) vorgenommene Unterscheidung von „Gesellschaft“ und „Gemeinschaft“ gehört zu den Klassikern der deutschen Soziologie. Obwohl sich der in diesem Rahmen entstandene Gesellschaftsbegriff mehr als grundlegend von jenem der soziologischen Systemtheorie nach Luhmann unterscheidet, welchen auch wir hier verwenden, so bietet die Unterscheidung nach Tönnies, nach der die Gesellschaft eine Art Abgrenzungsbegriff zur Gemeinschaft ist, doch einige interessante Implikationen, die es wert sind, auch beim Blick auf gesellschaftliche Entdifferenzierung im Nationalsozialismus näher beleuchtet zu werden.
Die Gemeinschaft gilt demnach als ein „älterer Modus kollektiver Existenz“ (Zapfel / Promberger 2011: 7), welcher sich etwa in traditionellen Großfamilien, Dorfgemeinschaften und religiösen Gemeinden manifestierte, sich durch traditions- und affektbasierte Lebensverhältnisse, eine hohe Interaktionsdichte, emotionale Nähe, Gefühlstiefe und gegenseitige Hilfsbereitschaft und persönliche Beziehungen auszeichnete und in der sich die Individualität dem Kollektiv unterzuordnen hat (vgl. Zapfel / Promberger 2011: 7). Die Gesellschaft ist nach Tönnies demgegenüber ein modernes soziales Phänomen und ein Produkt von Industrialisierung und der daraus resultierenden verstärkten Interdependenz einer immer größeren Anzahl von Menschen miteinander. Da diese jedoch aufgrund ihrer deutlich höheren Anzahl zumeist in einem anonymen Verhältnis zueinander stehen – also nicht zwingend miteinander interagiert wird – hat das Kollektivbewusstsein in der Gesellschaft stark an Bedeutung eingebüßt: Stattdessen müssen nun Symbole wie Flaggen, Hymnen und Währungen dem Einzelnen das Gefühl sozialer Zugehörigkeit vermitteln (vgl. ebd.: 10). Gesellschaft wird in diesem Sinne also noch als Nationalgesellschaft und somit mit dem Politischen verquickt verstanden: „Fiktive Gemeinschaftskonstrukte (…) – teils ideologisch überhöht wie Volks- und Schicksalsgemeinschaft – wurden im politischen Diskurs eingeführt, um auf Gesellschaftsebene eine Vertrautheit der Menschen miteinander zu suggerieren“ (ebd.: 10).
Nun ist dies zwar ein grundlegend anderer Zugang zum Begriff der Gesellschaft als der einer „Gesamtheit aller Kommunikationen“, aber gerade in der Abgrenzung zur Gemeinschaft wird eine ähnliche Vorstellung von gesellschaftlicher Evolution deutlich: Wo Luhmann den Übergang von segmentär und stratifiziert differenzierten hin zur funktional differenzierten Gesellschaft ausmacht, da sieht Tönnies (1926) den Übergang von der Gemeinschaft zur Gesellschaft. Stärker auf Interaktion basierende „Segmente“ und Gemeinschaften in der Ständegesellschaft werden durch von der Interaktionsebene klar zu unterscheidende gesellschaftliche Funktionssysteme ersetzt, die – parallel auch zu modernen Prozessen wie der Urbanisierung – soziales Zusammenleben „anonymisieren“. Ein wesentlicher Vorgang, der diese Anonymisierung bzw. Loslösung von Interaktion als leitendem Kommunikationsmodus begleitet (oder gar vorantreibt?) ist der der funktionalen Ausdifferenzierung. Indem diese auf die Weltgesellschaft hinarbeitet, indem sie Kommunikation vom regionalen Rahmen löst, indem sie Kommunikation, mit Carl Schmitt (2015: 81) gesprochen, entpolitisiert, treibt er das voran, was Tönnies unter Gesellschaft versteht.
Das oben bereits angedeutete, „ideologisch überhöhte, fiktive Gemeinschaftskonstrukt“ der Volksgemeinschaft ist eines der tragenden Konzepte des Nationalsozialismus gewesen. Es spricht jedoch vieles dafür, dass es hier um mehr ging als um einen Versuch, im politischen Diskurs zwischenmenschliche Vertrautheit zu suggerieren. Der Begriff der „Volksgemeinschaft“ war mehr als bloß propagandistische Rhetorik seitens des Regimes – er war die intendierte Konsequenz dessen, was mit einer Re-Politisierung der Gesellschaft in jenem Sinne, in dem etwa Schmitt (2015) sie beabsichtigt hatte, und damit mit einer umfassenden gesellschaftlichen Entdifferenzierung, eintreten sollte. Das, was nach Schmitt das Politische ausmacht, nämlich die Unterscheidung von Freund und Feind, schuf, sicherte und bewahrte nach dieser Auslegung die Volksgemeinschaft, indem es sie von „feindlichen“ Elementen abgrenzte und politische Institutionen installierte, die dieses weiterhin umsetzen und gewährleisten sollten. Die „totalitäre“, vom politischen System ausgehende Entdifferenzierung sollte eben diese umfassende (Re-)Politisierung der Gesellschaft und damit ihre Transformation hin zu einer „Volksgemeinschaft“ einleiten, so dass „im Dritten Reich ‚das Politische‘ nicht einen abgegrenzten Sektor der Staatstätigkeit darstellt, sondern zum mindesten potentiell das gesamte öffentliche und private Leben umfaßt“ (Fraenkel 1984: 98).
Dabei ging es um weit mehr als nur „Suggestion“: Die Rückkehr zum Kollektiv, welches über dem Individuum steht, war ja nicht bloße Rhetorik, sondern politisches Programm („Du bist nichts, dein Volk ist alles!“). Das, was nach Tönnies also die „Gemeinschaft“ ausmacht und was hier aus ersichtlichen Gründen schwer erreicht werden konnte, nämlich eine hohe Interaktionsdichte als „Bindungsmittel“, sollte kompensiert werden nicht nur durch die oben genannte, politisch übliche Symbolik, sondern durch andere, eher „reichsweit“ zu verwirklichende Gemeinschaftselemente wie eben jene traditions- und affektbasierten Lebensverhältnisse, der besagte Kollektivismus oder politisch organisierte gegenseitige Hilfsbereitschaft innerhalb der Volksgemeinschaft (das sozialistische Element des Dritten Reiches), etwa in Form des „Winterhilfswerks“ und zahlreicher anderer Einrichtungen. Der größte und wichtigste Integrator war aber eben der politische Funktionscode: Die soziale Konstruktion eines gemeinsamen Feindes schafft untereinander Integration und füllt dadurch jene Lücke, die sich durch den Mangel an Nähe durch Interaktion auftut. Die Volksgemeinschaft kann also in diesem Sinne durchaus als eine neuartige, politisch organisierte Form von Gemeinschaft im Sinne Tönnies‘ gesehen werden, die sich zwar teils durch einen anderen Charakter als die klassische (und schlicht kleinere) Gemeinschaft auszeichnet, die aber eben weit mehr ist als nur suggestive Rhetorik, und die auf eine umfassende Transformation dessen hinzielt, was in diesem Sinne die Gesellschaft darstellt.
Aus dieser Diagnose lässt sich ableiten, was Entdifferenzierung im Sinne einer Politisierung der Gesellschaft eben auch zu sein scheint: Eine Reaktion auf die gesellschaftliche Evolution nicht nur hin zur funktionalen Differenzierung, sondern auch zu dem, was Tönnies unter „Gesellschaft“ versteht. Beides erhöhte die Komplexität und die Kontingenz der Gesellschaft, was zu einer „Modernisierungskrise“ führte. Die Schritte hin zu einer politischen Neucodierung im Sinne der Unterscheidung von Freund und Feind, zur daraus generierten Inklusion all jener, die unter die Positivseite des Codes fielen, zur massiven und letztlich totalen Exklusion all jener, die man der Negativseite zurechnete, und damit letztendlich zur politisch determinierten Ausdifferenzierung einer nationalsozialistisch geformten Volksgemeinschaft stehen damit in einem jeweils unmittelbaren sozialstrukturellen Zusammenhang zueinander. Die Vorstellung von der deutschen Volksgemeinschaft war, letzten Endes, die Gesellschaftstheorie des Nationalsozialismus. Im Rahmen NS-rechtstheoretischer Semantik wurde das Primat des Politischen so etwa auch als „Primat des Volkes“ gedeutet (vgl. Dräger 1935).
Wir haben diesen Exkurs an dieser Stelle eingeschoben, um damit deutlich zu machen, dass die nationalsozialistische Vorstellung der Volksgemeinschaft nicht nur ein abstraktes oder oberflächliches, politrhetorisches Schlagwort darstellte, sondern ein politisches Konzept, ein politisches Programm, dessen Umsetzung, wie Kruse gezeigt hat (s. o.), mittels der aus der Freund-Feind-Unterscheidung folgenden, aktiven Inklusions- und Exklusionspolitik klar erkennbar angestrengt wurde. In diesen Zusammenhang lässt sich sodann auch die (mindestens versuchte) funktionale Entdifferenzierung zwischen Politik und Recht bzw. auch jene zwischen dem politischen System und anderen Funktionssystemen neben dem Recht einordnen: Die Politisierung der Gesellschaft unter der Maßgabe des politischen Codes, die „feindliche(n) Übernahme(n)“, um Schimanks (2006) Terminologie zu verwenden, hatte(n) aus Sicht der Nationalsozialisten den Sinn der gesellschaftsstrukturellen Transformation hin zur Volksgemeinschaft, zur Verwirklichung der nationalsozialistischen Gesellschaftstheorie. Gesellschaftsweite Inklusion der „Volksgenossen“ bzw. gesellschaftsweite Exklusion aller, die man nicht dazuzählte, war eben nur durch umfassende gesellschaftliche Kontrolle durch das dementsprechend gepolte politische System zu verwirklichen – nicht aber unter der Bedingung weiterhin bestehender Autonomie der übrigen gesellschaftlichen Teilsysteme: „Wird die Volksgemeinschaft zum Fetisch erhoben, so folgt daraus (…) die Negierung des Rechts als Eigenwert, die Absage an jegliche rationale naturrechtliche Normen und die Identifizierung von Recht und Zweckmäßigkeit“ (Fraenkel 1984: 233; Hervorhebungen F. S.).
Fraenkel beschreibt damit, in seinen Worten, nichts anderes als den politisch determinierten Autonomieverlust des Rechtssystems. Für die NS-Rechtstheorie formulierte Heinz Hildebrandt diese Politisierung des Rechts durch die Ideologie der Volksgemeinschaft wie folgt: „Endzweck allen Rechts ist im nationalsozialistischen Staat die Sicherung und Förderung der deutschen Blutsgemeinschaft“ (Hildebrandt 1935: 56). Das Recht sollte fortan unter dem Primat der politischen Freund-Feind-Unterscheidung funktionieren. Die für den Autonomieverlust des Rechts ursächliche funktionale Entdifferenzierung als Teil der NS-Programmatik bildet dabei das maßgebliche Herrschaftsinstrument: „Gäbe es keine Volksgemeinschaft, könnte man Gemeinschaften, die sich auf religiöse, soziale oder politische Werte gründen, nicht unterdrücken“ (Fraenkel 1984: 233). Im Zweifel müsste ein Feind erfunden werden, wenn es keinen realen mehr gäbe, um den Mythos vom Dauernotstand (bzw.: den Ausnahmezustand) aufrecht zu erhalten – und damit die Volksgemeinschaft (vgl. Fraenkel 1984: 233).
Literatur
Dräger, Werner (1935). Primat des Volkes. Ein Beitrag zur Grundfrage einer völkischen Staatslehre. Neue Deutsche Forschungen, Bd. 34. Berlin: Junker und Dünnhaupt.
Fraenkel, Ernst (1984). Der Doppelstaat. Recht und Justiz im „Dritten Reich“. Frankfurt a. M.: Fischer.
Hildebrandt, Heinz (1935). Rechtsfindung im neuen deutschen Staate. Ein Beitrag zur Rezeption und den Rechtsquellen, zur Auslegung und Ergänzung des Gesetzes. Schriften der Akademie für Deutsches Recht. Berlin / Leipzig: Walter de Gruyter.
Kruse, Volker (2015). Kriegsgesellschaftliche Moderne. Zur strukturbildenden Dynamik großer Kriege. München / Konstanz: UVK.
Schimank, Uwe (2006). „Feindliche Übernahmen“: Typen intersystemischer Autonomiebedrohungen in der modernen Gesellschaft. In: Ders., Teilsystemische Autonomie und politische Gesellschaftssteuerung: Beiträge zur akteurszentrierten Differenzierungstheorie 2. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 71-83.
Schmitt, Carl (2015). Der Begriff des Politischen. Text von 1932 (9., korrigierte Aufl.). Berlin: Duncker & Humblot.
Tönnies, Ferdinand (1926). Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie (7. Aufl.). Berlin: Curtius.
Zapfel, Stefan / Promberger, Markus (2011). Gemeinschaft, Gesellschaft und soziale Sicherung. Überlegungen zu Genese und Wandel des modernen Wohlfahrtsstaats. IAB Discussion Paper, 21/2011. http://doku.iab.de/discussionpapers/2011/dp2111.pdf (letzter Zugriff: 02.07.2020)
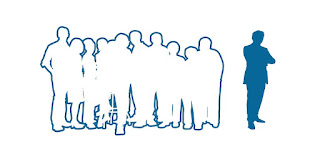


Kommentare
Kommentar veröffentlichen
Anonyme Kommentare werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie bei einem Kommentar Ihren richtigen Namen an. Dazu wählen Sie die Option "Name / URL". Die Angabe einer URL ist dafür nicht zwingend erforderlich. Verzichten Sie bitte auf Pauschalisierungen und bleiben Sie sachlich. Vielen Dank.